So finanziert sich diakonische Arbeit
Die Diakonie Deutschland ist der Zusammenschluss von circa 5.000 rechtlich eigenständige Trägern mit rund 34.000 Einrichtungen, die nach gemeinsamen Wertvorstellungen handeln. Wie wir diakonische Arbeit finanzieren, können Sie hier nachlesen.
08.01.2026
Was Sie auf dieser Seite finden
Soziales Unternehmertum
Die Diakonie ist der soziale Dienst der evangelischen Kirche. Sie versteht ihren Auftrag als gelebte Nächstenliebe. Die Angebote der Diakonie stehen allen Menschen offen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Alter oder sexueller Identität.
Selbstlos wird alles wirtschaftliche Handeln diesem Ziel und Zweck untergeordnet. Gewinne an Aktionäre, Vorstände oder Vereinsmitglieder auszuschütten, widerspricht diesem Ziel und der satzungsmäßigen Gemeinnützigkeit. Überschüsse zu erwirtschaften gehört zwar zu einer guten Haushaltsführung, ist aber kein Selbstzweck, sondern dient der strategischen Entwicklung der Einrichtung. Überschüsse dienen der Finanzierung von künftigen Investitionen, Modernisierungen oder Anschubfinanzierungen für neue Aufgaben. Der Gemeinnützigkeitsstatus verpflichtet uns, Überschüsse zeitnah und ausschließlich für den Satzungszweck einzusetzen.
Diakonie vor Ort
Unser Netzwerk ist groß: Der Diakonie Deutschland sind circa 5.000 Rechtsträger mit rund 34.000 Angeboten für die Pflege, Betreuung und Begleitung von Menschen angeschlossen. Sie arbeiten nach gemeinsamen Wertvorstellungen in sozialen Arbeitsfeldern auf der Basis des christlichen Glaubens nach evangelischem Bekenntnis. Auf Landes- und Bundesebene arbeiten sie bei übergreifenden Aufgaben und für gemeinsame Ziele in Verbänden zusammen. In der Diakonie engagieren sich über eine Million Menschen. 687.000 Frauen und Männer arbeiten hauptamtlich bei der Diakonie. Maßgeblich gestützt wird diese Arbeit durch über 700.000 freiwillig Engagierte. Etwa zehn Millionen Menschen erhalten von der Diakonie jährlich Betreuung, Beratung, Pflege oder medizinische Versorgung.
Diakonie im Sozialsystem
Mit dem Sozialstaatsprinzip verpflichtet das Grundgesetz den Staat Menschen insbesondere in Notlagen, die sie aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen können, zur Seite zu stehen und derartigen Notlagen vorzubeugen. Die diakonischen Einrichtungen übernehmen dabei nach dem sogenannten Prinzip der "Subsidiarität" gesellschaftliche Aufgaben, die allen zugute kommen. Was heißt Subsidiarität? Insbesondere nach den Erfahrungen des Dritten Reiches, wollte man, dass der Staat nicht zentralistisch für alles zuständig ist. Vielmehr sollten möglichst viele und breit aufgestellte gesellschaftliche Gruppen zum Wohl der Gesellschaft tätig werden. Nach diesem Subsidiaritätsprinzip überträgt der Staat soziale Aufgaben - zum Beispiel auf der Basis des Bundessozialhilfegesetzes - an freie Träger. Würde sich die Diakonie aus diesen Arbeitsbereichen zurückziehen, wäre der Staat allein kaum in der Lage, die notwendigen Aufgaben und gesellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen.
Allerdings werden selten die gesamten Kosten übernommen. Kaum ein Angebot der Diakonie kommt ohne Eigenmittel aus, etwa in Form von Kirchensteuern oder Spenden.
Finanzierungsformen diakonischer Arbeit
Die Arbeit der Diakonie finanziert sich aus unterschiedlichen Quellen. Finanzierungsquellen können sein
Unsere Arbeitskriterien
Betriebswirtschaftliche und personelle Entscheidungen treffen die jeweiligen Verantwortlichen vor Ort. Gemeinsam hat der Verband Kriterien im Bereich der Transparenz und Nachhaltigkeit erarbeitet, nach denen wir handeln wollen.
Die Diakonie in Zahlen
Wir verstehen unseren Auftrag als gelebte Nächstenliebe und setzen uns für Menschen ein, die am Rande der Gesellschaft stehen, die auf Hilfe angewiesen oder benachteiligt sind.
-
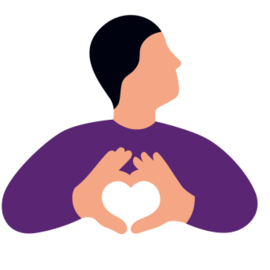 © Diakonie/Francesco Ciccolella
© Diakonie/Francesco Ciccolella
700000
Ehrenamtliche
-
 © Diakonie/Francesco Ciccolella
© Diakonie/Francesco Ciccolella
687000
Mitarbeitende
-
 © Diakonie/Francesco Ciccolella
© Diakonie/Francesco Ciccolella
10 Mio.
Klientinnen & Klienten