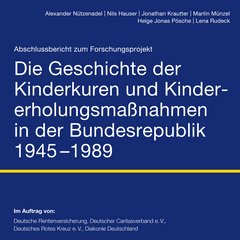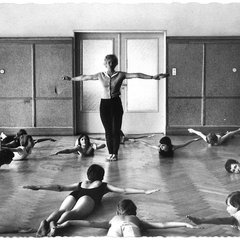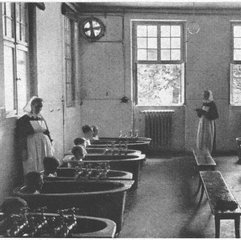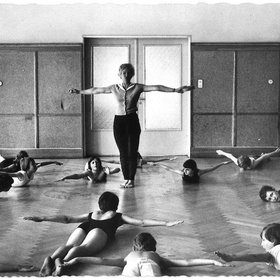Die Bundespolitik hat von Anfang an zurückhaltend reagiert. Das Bundesforschungsministerium (BMBF) hat einen eigenen Forschungsantrag der Initiative abgelehnt, und auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat sich bisher nicht klar zu einer Unterstützung bekannt, nachdem Ministerin Franziska Giffey (SPD) im Frühjahr 2020 erklärt hatte, einen Vorstoß der Länder zu prüfen. Im Landtag von Nordrhein-Westfalen wurde das Thema durch einen Antrag der SPD-Fraktion aufgegriffen; daraufhin wurde in NRW ein Runder Tisch Kinderverschickungen eingerichtet.
Auf Initiative von Landesregierungen (Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) hatte sich die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) am 27. Mai 2020 mit dem Thema befasst. In einem Beschluss erkennt die Konferenz das Leid an. Es zeige sich, dass es sich um ein bundesweites Phänomen gehandelt habe, an welchem verschiedenste Institutionen beteiligt waren. Die Minister:innen erzielten Einigkeit, „dass die Geschehnisse in den Heimen, die Anzahl der Betroffenen und die institutionellen, strukturellen, individuellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umfassend aufgeklärt werden müssen“. Der Sozialminister Baden-Württembergs, Manfred Lucha (B90/Grüne) äußerte sich gegenüber der ARD, dass die Selbstorganisation und die Aufarbeitung aus öffentlichen Mitteln gefördert werden sollen. Bislang ist eine solche institutionelle Förderung nur aus Baden-Württemberg und NRW bekannt.
Die Forderung nach Aufarbeitung der Kinderverschickungen ist mittlerweile Teil des aktuellen Regierungsprogramms geworden. In Zeile 3212/3 des Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU und SPD heißt es: „Wir unterstützen die Aufarbeitung der Misshandlungen von Kindern bei Kuraufenthalten zwischen 1950 und 1990 durch die ‚Initiative Verschickungskinder‘.“